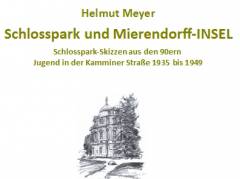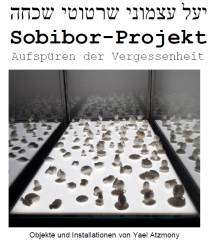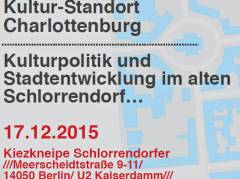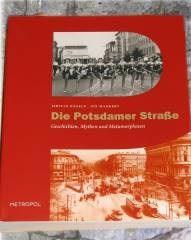„Die Sache Makropulos“ an der Deutschen Oper
„Das Ewigweibliche zieht uns hinan“, mit diesen Worten läßt Goethe das große deutsche Nationalepo „Faust“ ausklingen. Dem schon greisen Dichterfürsten führte die gleiche Triebfeder die Hand, die auch Leos Janacek zu seinen bedeutenden nationalen Musikwerken der Tschechen inspiriert hatte.
Was dem Goethe seine Ulrike von Levetzow war Leos Janacek die Kamila Stösslová, der die Nachwelt etliche musikalische Meisterwerke unter anderem die Oper „Das schlaue Füchslein“ zu verdanken hat, die an der Deutschen Oper 2000 Premiere hatte. Jetzt wird der Janacek-Schwerpunkt an der Deutschen Oper mit der Premiere von „Die Sache Makropulos“ fortgeführt, die wie schon das „schlaue Füchslein“ von der unerfüllten Liebe des Komponisten zu der wesentlich jüngeren Kamila Stösslová inspiriert ist. Für Janacek war die Melodik seiner Muttersprache von großer Bedeutung. In seinen Kompositionen geht deshalb der Text eine enge Verbindung mit der Musik ein. Deshalb hat sich die Deutsche Oper entschlossen, diese Verbindung nicht durch eine Übersetzung aufzubrechen und die Oper in tschechischer Sprache aufzuführen. Die Dialoge werden deutsch und englisch übertitelt.
Mit den Regisseuren Katharina Thalbach und David Hermann sowie der musikalischen Leitung von Donald Runnicles wird dieser Janacek-Schwerpunkt herausragenden Künstlern anvertraut, die dem Haus zur Verfügung stehen.
Wichtiger noch als diese Kontinuität ist die Linie der Frauenfiguren von der „Lady Macbeth von Mzensk“ über „Salome“ bis zur jüngsten Premiere weitergeführt wird. Es sind Frauen, die die gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit aufsprengen und bis zur letzten Konsequenz kompromißlos ihre Lebensansprüche durchsetzen. Für die Verkörperung solcher Frauen setzt Evely Herlitzius an der Deutschen Oper mittlerweile Maßstäbe, was sie erst kürzlich in der Titelrolle der „Lady Macbeth von Mzensk“ zeigte.
Erstaunt fragen sich die Anwälte, woher Emilia Marty (sitzend) die
Kentniss
von über 100 Jahren zurückliegender Vorgänge hat.
Foto: Wecker
Emilia Marty sucht die Rezeptur des lebenverlängernden Elixiers.
Foto: Wecker
[weiterlesen]
FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -
Alles neu? Keramik in Deutschland 1918 – 1933
Die große Sonderausstellung „Berlin und Brandenburg. Keramik der 20er und 30er Jahre“, vom KMB initiiert und gemeinsam mit dem Deutschen Historischen Museum 1992 im Berliner Zeughaus durchgeführt, stellte die Keramikproduktion der Kulturmetropole Berlin und der Mark Brandenburg in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen grundlegend dar.
Nach der 2012 im KMB präsentierten Ausstellung „Form – Funktion – Ideologie“, in der die keramischen Entwicklungen und Strömungen zur Zeit der NS-Diktatur aufgezeigt wurden und sich das Museum 2013 der „Deutschen Keramik um 1900“ widmete, werden nun Einblicke in das keramische Schaffen während der Zeit der Weimarer Republik möglich.
Geprägt wird diese Zeit von drei Abschnitten: die Nachkriegszeit mit der Inflation, die 1923 ihren Höhepunkt und ihr Ende erreichte, den so genannten Goldenen Zwanziger Jahren, die anschließend auch der deutschen Kunst und Kultur eine Blütezeit bescherten und schließlich der Weltwirtschaftskrise, die ihren Anfang mit dem New Yorker Börsenkrach im Oktober 1929 nahm und in den Folgejahren viele Insolvenzen und Betriebsschließungen auch im keramischen Sektor nach sich zog.
In der neuen Ausstellung sind sowohl bedeutsame Künstler vertreten als auch eine Auswahl richtungsweisender Werkstätten, die das keramische Schaffen in der Zeit der Weimarer Republik repräsentieren. Die Ideen des Bauhauses und des Werkbundes standen in jenen Jahren einer Entwicklung der individuellen Studiokeramik gegenüber. Mit den gezeigten Keramiken - Unikate und Serienstücke - werden eindrucksvoll sowohl die Suche nach der idealen Form als auch das Finden einer eigenen, persönlichen Gestaltung sichtbar. Die rund 120 Exponate stammen zum überwiegenden Teil aus der museumseigenen Sammlung und sind durch private Leihgaben ergänzt.
Die Ausstellung wird vom 5. Februar bis zum 15. August 2016 gezeigt.
Walter A. Heufelder zum 90. Geburtstag
75 Jahre keramisch tätig, seit 55 Jahren Töpfermeister - und noch immer nicht arbeitsmüde.
Walter A. Heufelder ist ohne Zweifel ein Ausnahmekeramiker und -künstler. Nicht nur auf dem Gebiet der Gefäßkeramik, sondern auch im bildhauerischen Bereich zeigt er seine Qualitäten. Während seiner 34 Jahre Lehrtätigkeit an verschiedenen Unterrichtsanstalten prägte er zahlreiche junge Menschen, die das Töpferhandwerk erlernten, indem er die unterschiedlichsten Ansätze vermittelte, ohne sie ihnen aufzuzwingen. Als Praktiker besticht Heufelder dadurch, dass er nahezu alle Arbeitstechniken und den Umgang mit verschiedenen keramischen Materialien in hoher Qualität beherrscht, wobei er sich nie auf eine einmal erarbeitete Linie festlegt.
Lange bleibt er der auf der Töpferscheibe gedrehten Gefäßkeramik verbunden, zuletzt 1989 in einer Sonderausstellung in Berlin gezeigt. In den vergangenen 10 Jahren liegt ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit bei eindrucksstarken plastischen Arbeiten in Form von „Stelen“ und „Rollen“, die er mit Schriftzeichen verschiedener alter Kulturen versieht. In der Kabinettausstellung des KMB werden Gefäße von den 1960er bis 1990er Jahren und Objekte der letzten Dekade präsentiert.
Walter A. Heufelder wurde 1926 in Höhr (-Grenzhausen) geboren. Einige der zahlreichen Stationen seines Wirkens waren:
Lehrer am Institut für Werkpädagogik in Köln; 1967-75 Lehrbereichsleiter Bildhauerei-Keramik an den Kölner Werkschulen; 1975-88 Direktor der Staatlichen Berufsschule, Berufsfachschule und Fachschule für Keramik Landshut; 1983 Gründungsmitglied der Deutschen Keramiker „Gruppe 83“.
Seit 1961 wurden zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen seiner Werke in Deutschland, mehreren europäischen Ländern sowie Afrika, Asien und Kanada gezeigt. 1965 erhielt er den Staatspreis für das Kunsthandwerk Nordrhein-Westfalen; 1976 wurde er als Mitglied in der Académie Internationale de la Céramique Genf aufgenommen; 1985 ehrte man ihn mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und 1995 mit dem Kulturpreis Ostbayern. Der Künstler lebt und arbeitet in Kumhausen-Obergangkofen bei Landshut.
Die Ausstellung wird vom 5. Februar bis zum 28. März 2016 gezeigt.
Eröffnung beider Ausstellungen:
Freitag, 4. Februar 2016 um 19:00 Uhr
Es spricht Frau Dr. Mayako Forchert, Kunsthistorikerin.
Walter A. Heufelder ist anwesend.
Keramik-Museum Berlin (KMB)
Schustehrusstraße 13, 10585 Berlin-Charlottenburg
Öffnungszeiten:
Fr - Mo von 13:00 bis 17:00 Uhr
Eintritt 4,00 Euro, ermäßigt 2,00 Euro
- Kunst und Kultur -
Ausstellung und Vortrag von Helmut Meyer:
Jugend in der Kamminer Straße 1935 bis 1945 und Schlosspark-Skizzen aus den 90er Jahren
Helmut Meyer
ist von 1935 bis 1949 in der Kamminer Straße 35 im Mierendorff-Kiez aufgewachsen. Sein
Vater war als Kommunist verhaftet, seine Mutter mußte sich und ihren
Sohn allein durchbringen. Diese frühe Kinder- und Jugendzeit im Kriegs- und
Nachkriegs-Berlin hat Helmut Meyer für seine Enkel in Zeichnungen und Texten festgehalten. Er schrieb dazu:
„Der Sprung ins Jahr 1989 zog mich in den Schlosspark zurück. Getilgte Wunden des Krieges und der Zeit waren rein äußerlich. An den Orten der Skizzen kamen aber dann doch wieder die Erinnerungen. Der Charlottenburger Schlosspark gehört nun mal zu meinem Lebenslauf.“
Herr Meyer strolchte auf seinen frühen Erkundungen natürlich auch durch unseren Kiez am Klausenerplatz und kannte noch das Kino in der Neufertstraße.
Das Haus am Mierendorffplatz und Helmut Meyer laden alle Interessierten herzlich ein, mit ihm in die Geschichte dieses Ortes einzutauchen und eigene Erfahrungen auszutauschen.
Die Ausstellung wird vom 1. bis zum 26. Februar 2016 präsentiert.
Ausstellungseröffnung, Vortrag und Gespräch
Dienstag, 9. Februar 2016 von 18:00 bis 19:30 Uhr
Haus am Mierendorffplatz
Mierendorffplatz 19, 10589 Berlin-Charlottenburg
- Geschichte, Kunst und Kultur, Menschen im Kiez -
Benefizkonzert für „Moabit hilft“
Die Initiative „Moabit hilft“ lädt am Donnerstag, 4. Februar, um 20 Uhr zu einem außergewöhnlichen Benefizkonzert in die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz.
Unterstützerin der Initiative ist die mehrfach preisgekrönte Berliner Pianistin SooJin Anjou. Sie hat ihr internationales Renommee geltend gemacht und für dieses Konzert einen der beliebtesten Dirigenten aus ihrem Geburtsland Südkorea, Nanse Gum, mit seinem Kammerorchester „Hankyung Sinfonietta“ gewinnen können, in der Gedächtniskirche dieses Benefizkonzert zu geben. Auf dem Programm stehen Werke von Vivaldi, Grieg, Weber und Respighi. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Spende zugunsten der Flüchtlinge gebeten.
SooJin Anjou selbst wird bei diesem Konzert nicht auftreten. Interessenten seien auf ihr nächstes Konzert am 28. und 29. Mai um 16 Uhr im Schloß Glienicke nach Auftritten in Schweden, Südkorea und auf Malta vertröstet.
Frank Wecker
Die Pianistin SooJin Anjou unterstützt „Moabit hilft“.
Fotos: Wecker
FW - Gastautoren, Gesellschaft, Kunst und Kultur -
Deutsche Oper rebelliert
Mit zwei neuen Produktionen, deren einzige Gemeinsamkeit in der Provokation durch das Sujet besteht, wartet die Deutsche Oper in der Bismarckstraße 35 auf.
„Salome“ – auch nach 100 Jahren provokant
Am Sonntag, 24. Januar, hatte im großen Haus „Salome“ von Richard Strauss Premiere.
Eine Flucht nach Dresden wie vor 110 Jahren, weil die Enthauptung eines Familienvaters durch eine liebestolle Stieftochter und der „Tanz der sieben Schleier“ doch die biederen Bürger im preußischen Machtzentrum irritierte, ist heute nicht zu befürchten. Schon allein deshalb nicht, weil etliche beteiligte Künstler Ausländer sind. Die musikalische Leitung hat der Pariser Alain Altinoglu, der von armenischen Einwanderern abstammt. Die Titelpartie singt die US-Amerikanerin Catherine Nagelstad und ihre Mutter Herodias wird ebenfalls von einer US-Amerikanerin, Jeanne-Michele Charbonnet, interpretiert. Regie führt Claus Guth. Bis Ende Februar ist der Berliner Opernstar Burkhard Ulrich in der Rolle des Herodes zu erleben und Jochanaan wird von Michael Volle gespielt, der schon auf vielen bedeutenden Opernbühnen der Welt gestanden hat.
Mit dem Libretto eines Autors, Oscar Wilde, der wegen „grober Unsittlichkeit“ zwei Jahre inhaftiert war, läßt sich selbst der biedere Bürger heute nicht mehr erschrecken. Eher wird es brisant, wenn die Auseinandersetzung in einer kaputten Familie, wo der Stiefvater schon seine kindliche Tochter mißbraucht und die Mutter sie nicht schützen will, auf die Ebene der ganz aktuellen Auseinandersetzung zwischen den Religionen des Judentums, des Islam und des Christentums gehoben wird. So nimmt die Regie wenig Rücksicht auf die klassische Dramenstruktur und verlegt einen Teil der Handlung von der Terrasse des Königspalastes in eine Maßschneiderei und verteilt damit die ursprünglich angelegte Einheit von Raum und Zeit auf mehreren Spielebenen. Aus den sieben Schleiern werden sieben Stufen der Kindheit der Salome und schließlich schafft sie sich ihren Retter Jochaan als eine Gegenfigur zum Herodes. Jochaan ist der Prophet Johannes der Täufer, ein jüdischer Bußprediger, der sowohl im palästinensischen Judentum wie auch in der Diaspora eine Rolle spielte. Im Urchristentum wurde er als Wegbereiter von Jesus und damit als Heiliger verehrt. Im Koran ist Johannes nach Jesus und Mohammed einer der drei wichtigsten Propheten. Dieser Mann weist Salomes Begehren zurück, worauf sie von ihrem Stiefvater als Gegenleistung für den Schleiertanz dessen Kopf fordert und ihn auch – in der Legende – auf einem Silbertablett erhält. In dieser Inszenierung fällt ein Kopf gewissermaßen am Tisch bei der Familienmahlzeit, wo er dann den Platz von Herodes einnimmt.
Salome erinnert sich ihrer Kindheit.
Foto: Wecker
Die kindliche Salome entzückt mit ihrer jugendlichen Schönheit die Herrschaft.
Foto: Wecker
Salome begegnet erstmals Jochanaan,
der von Herodes in einer Zisterne gefangen gehalten wird (Bild li.).
Salome und ihr Stiefvater Herodes (Bild re.).
Fotos: Wecker
[weiterlesen]
FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -
- "COCIDO JAM" in der Kulturwerkstadt
"Cocido" ist ein "Eintopf" mit ganz vielen unterschiedlichen Zutaten,
die in diesem Fall ein Mix der unterschiedlichsten Musikrichtungen sein
könnte..... Alle die ein Instrument spielen, und Lust haben an der
"Zubereitung" teil zu haben oder aber auch nur zuhören möchten, sind
herzlich eingeladen. Bringt Eure Instrumente oder halt nur Eure Ohren
mit..... Jeder ist willkommen !
Eintritt frei - Spende erbeten.
Dienstag, 19. Januar 2016
Einlass: 19:30 / Beginn: 20:00 Uhr
Kulturwerkstadt (in der ehemaligen Engelhardt-Brauerei)
Danckelmannstraße 9 A
14059 Berlin-Charlottenburg
- Vortrag im Keramik-Museum Berlin
Im Januar stellte das rbb-Inforadio das von Herrn Theis geleitete Keramik-Museum in Charlottenburg vor.
Zwei Tage vor dem Ende der Ausstellungen "Sobibor-Projekt. Aufspüren der Vergessenheit" und "Waltraud Eich. Keramik der 1950er Jahre" wird die israelische Künstlerin Yael Atzmony in einem Vortrag die Hintergründe zu ihrem "Sobibor-Projekt" erläutern und ihre Arbeitstechniken vorstellen.
Eintritt 4,- Euro (inkl. Besuch der 3 Sonderausstellungen)
Samstag, 23. Januar 2016 um 17:30 Uhr
Keramik-Museum Berlin (KMB)
Schustehrusstraße 13, 10585 Berlin-Charlottenburg
Öffnungszeiten:
Mo - Fr von 12:00 bis 17:00 , Sa u. So von 13:00 bis 17:00 Uhr
- Neujahrsempfang im WESTRAUM
Die Initiatorin Anita Staud lädt zum Neujahrsempfang unter dem Motto "voir La vie en rose" in den Wilmersdorfer Projektraum ein.
Gezeigt werden Bilder, Skulpturen, Fotos und Objekte von zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern - mit einer Einführung von Richard Rabensaat, Musik und Performance.
Sonntag, 24. Januar 2016 ab 17:00 Uhr
WESTRAUM
Nestorstrasse 36
10709 Berlin-Wilmersdorf
Weitere KurzInfos zu Veranstaltungen und Themen rund um den Klausenerplatz-Kiez immer auch
bei Twitter (ohne Anmeldung einsehbar!) und
bei Facebook.
Weitere Termine auch stets im StadtteilKalender für Charlottenburg-Wilmersdorf des Nachbarschaftshauses am Lietzensee.
- Kunst und Kultur -
Künstler aus aller Welt unterstützen UNICEF
Bis zum 10. Februar macht die Ausstellung „23 internationale Kunstherzen für UNICEF“ in der Filiale der Commerzbank am Kurfürstendamm 237 Station.
Neugier erweckt einmal die Herausforderung an die Künstler, sich an eine strenge Formvorgabe zu halten. Es gilt, ein Motiv auf einer herzförmigen Scheibe in der Größe von 40 mal 40 Zentimetern aus Fichtenholz zu gestalten. Bemerkenswert ist zudem die Geschichte dieser Herzkunst und schließlich verwundert drittens, daß eine Bank, die schon den verpönten Begriff „Kommerz“ in ihrem Namen trägt, sich dennoch nicht allein den Geschäften widmet, sondern sich in der Gesellschaft weitgefächert engagiert. Selbst gegen den Grundsatz aller Public Relation „Tue Gutes und Rede darüber“ verstößt sie. Sie verschweigt einfach Teile ihres Engagements. Nur aus eigener Anschauung weiß der Verfasser dieser Zeilen, daß sie kleinen Initiativen wie der „Fondation Aman International“ hilft, ohne dies auch nur zu erwähnen, und selbst über die hier beworbene Aktion mit einer der bedeutendsten Hilfsorganisationen UNICEF findet sich auf der der Bank eigenen Internetpräsenz kein Hinweis. Allein schon deshalb sei diese Ausstellung den Lesern dieser Zeilen ans Herz gelegt.
Die türkische Künstlerin Meral Alma mit ihrem Bild „Die Ballerina Sevgi“.
Foto: Wecker
Die Künstlerinnen Meral Alma (Türkei) mit ihrem Bild „Die Ballerina
Sevgi“, Nadja Zikes (Slowenien) mit ihrem Bild „Syno – Kardia“ und
Theresa Kallrath (Schweden) mit dem Bild „Färgtagen“.
Foto: Wecker
[weiterlesen]
FW - Gastautoren, Gesellschaft, Kunst und Kultur -
- Kulturpolitik und Stadtentwicklung im alten »Schlorrendorf«
Die Geschichte von Charlottenburg-Wilmersdorf ist eine von Kultur- und Kunstvielfalt. Doch wie hat sich dieser „Standort“ in den vergangenen 25 Jahren verändert, auf wessen Kosten und wie muß Kulturpolitik als Teil von Stadtentwicklung gedacht werden?
Katrin Lompscher (MdA / Die Linke) diskutiert im Rahmen der Reihe "StadtGespräche" mit Volker Fischer (sozialwissenschaftliches büro berlin), Kulturstadträtin Dagmar König (angefragt), Stefan Evers (MdA / CDU) und den dazu herzlich eingeladenen Bürgern. Der Eintritt ist frei.
Donnerstag, 17. Dezember 2015, 18:30 bis 20:00 Uhr
Kultur-Club Westend im Schlorrendorfer
(Kiez- und Kulturgaststätte)
Meerscheidtstraße 9 - 11, 14050 Berlin-Westend
- »Mythos Gleisdreieck«
Die Industrielandschaft Gleisdreieck hat seit ihrer Entstehung Schriftsteller und Künstler fasziniert. Joseph Roth und Walter Mehring beschrieben sie expressiv, Günter Grass nutzte das Gleisdreieck als Symbol für die geteilte Stadt, Wim Wenders inspirierte es zu Szenen seines Filmes »Der Himmel über Berlin«. Mythos und Wildnis, Verkehr und Brache. Heute: gebändigte Stadtnatur und enthusiastisch gelobter Park.
Lesung und Gespräch mit:
- Andra Lichtenstein, Landschaftsarchitektin, und Flavia Alice Mameli, Produktdesignerin, sind zwei Stadtforscherinnen mit Leidenschaft für Berlin. Im Sommer 2015 erschien ihr Buch »Gleisdreieck/Parklife Berlin«, ein vielschichtiges bilinguales Portrait der Geschichte der Berliner Brachlandschaft und ihrer Entwicklung zum Park des 21. Jahrhunderts (Transcript-Verlag).
- Roland Kretschmer arbeitet als freier Rezitator. Deutschlandweit bekannt wurde er mit einer fünf Monate dauernden Gesamtlesung von Robert Musils »Der Mann ohne Eigenschaften«. Außerdem betreibt er die Weinbar Les Climats in der Pohlstraße.
- Matthias Bauer war Mitglied der Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck und ist Herausgeber des Gleisdreieck-Blogs.
- Sibylle Nägele und Joy Markert sind Autoren. 2011 erschien die erweiterte Neuauflage ihres Buches »Die Potsdamer Straße. Geschichten, Mythen und Metamorphosen«. Ab 2009 Betreiber des Literatur-Salon Potsdamer Straße mit Veranstaltungen wie »Annäherung an Herwarth Walden«, »War Walden Punk?«, »Lesung in zehn Runden«.
Eine Veranstaltung des Literatur-Salons Potsdamer Straße in Kooperation
mit [P103] Mischkonzern im Rahmen der Reihe: Charme-Offensive Potsdamer
Straße. Der Eintritt ist frei.
Sonntag, 20. Dezember 2015 um 17:00 Uhr
[P103] Mischkonzern, Potsdamer Straße 103
10785 Berlin-Schöneberg
- Geschichte, Kunst und Kultur -
- Female Session-Night in der Charlottenburger Kulturwerkstadt
»"Existas" ist ein "Netzwerk" das sich für die Gleichstellung der Geschlechter in der Musik-Szene einsetzt und das sich in der "KulturWerkstadt" bei seiner aller ersten "open stage & jam night" präsentiert. Der Abend wird mit einem Opening-Act beginnen, bei dem Netzwerkerinnen ihre musikalische Arbeit vorstellen. Anschließend ist die Bühne offen für eine Jam-Session. Macht euch auf den Weg Frauen! Bringt eure Songs, eure Instrumente und eure Freunde mit! Jede(r) ist herzlich wilkommen. Auf der Bühne aber gilt: "Ladies first!"«
Eintritt frei - Spende erbeten.
Donnerstag, 10. Dezember 2015
Einlass: 19:30 / Beginn: 20:00 Uhr
Kulturwerkstadt (in der ehemaligen Engelhardt-Brauerei)
Danckelmannstraße 9 A
14059 Berlin-Charlottenburg
- Lesung zur Schöneberger Stadtgeschichte
»Die Potsdamer Straße. Geschichten, Mythen und Metamorphosen«
Die Potsdamer Straße in Schöneberg war in ihrer Ausstrahlung und Widersprüchlichkeit schon immer eine der faszinierendsten Straßen Berlins: mit Alteingesessenen und Migranten, Kultur und Amüsement, Glanz und Milieu, Kontinuität und Brüchen. Sie war ein Ort der künstlerischen Neuerungen und der Emanzipationsbewegungen. Hier lebten Chamisso, Menzel, Fontane, Hedwig Dohm, Joseph Roth. 1910 wurde der »Berliner Sportpalast« eröffnet. 1913 veranstaltete Herwarth Walden den »Ersten Deutschen Herbstsalon« internationaler moderner Kunst. 1923 kam aus dem »Vox-Haus« die erste allgemeine Rundfunksendung. 1954 zog der Verlag »Der Tagesspiegel« in die Potsdamer Straße, er blieb hier bis 2009. 1970 wurde das »Quartier Latin« eröffnet, ein Ort für Jazz, Rock und Pop. Heute ist hier das Varieté »Wintergarten«. Das Buch zeigt alle Facetten der über zweihundertjährigen Geschichte in einer Symbiose aus Literatur und Dokumentation. Eine Liebeserklärung.
Eine Lesung mit Sibylle Nägele und Joy Markert.
Der Eintritt ist frei.
Sibylle Nägele und Joy Markert arbeiten seit 1994 kontinuierlich
zusammen: Romane, Erzählungen, Hörspiele, Kindergeschichten. 2006
erschien das Buch „Die Potsdamer Straße. Geschichten, Mythen und
Metamorphosen“. Inzwischen ist die zweite vollständig überarbeitete und
erweiterte Auflage erhältlich (ISBN 978-3-86331-052, Metropol Verlag,
Berlin 2011, 29,90 Euro). Seit Herbst 2009 gibt es ihren
»Literatur-Salon Potsdamer Straße« mit bisher weit über 100 öffentlichen
Veranstaltungen und Rundgängen.
Freitag, 11. Dezember 2015 um 19:00 Uhr
FLOTTWELL BERLIN - Hotel & Residenz am Park
Flottwellstraße 18, 10785 Berlin-Tiergarten
- Benefiz-Trödelmarkt im Keramik-Museum Berlin
Der Förderverein des Keramik-Museums Berlin lädt zum vierten vorweihnachtlichen Keramiktrödel bei Kaffee, Tee und Gebäck im stimmungsvollen, romantischen Ambiente des 300 Jahre alten Bürgerhauses ein. Der Erlös aus den Verkäufen kommt komplett dem gemeinnützigen Förderverein KMB e.V., der das Museum ohne öffentliche Förderung betreibt, zugute.
Neben dem Stöbern nach besonderen Weihnachtsgeschenken wird die Möglichkeit geboten, sich auch die aktuellen
Sonderausstellungen des Museums anzuschauen:
Zum Keramiktrödel gilt pauschal der ermäßigte Eintrittspreis von 2,- Euro (inklusive Besuch der Ausstellungen).
Samstag, 12. und Sonntag, 13. Dezember 2015
jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr
Keramik-Museum Berlin (KMB)
Schustehrusstraße 13, 10585 Berlin-Charlottenburg
- ARTVENT im WESTRAUM
Die Initiatorin Anita Staud lädt alle Kunstfreunde, Interessierte, Sammler, Künstler und sonstige Weltenbummler herzlich zum vorweihnachtlichen »Hämmern und Nageln« in ihren "Projektraum" ein:
„Kommt und schaut, was Künstler so treiben, zwischen Glühweinschwaden und Zimtsternen, wohnt der Entstehung eines künstlerischen Bandes bei.“
Sonntag, 13. und 20. Dezember 2015
jeweils von 15:00 bis 19:00 Uhr
WESTRAUM
Nestorstrasse 36
10709 Berlin-Wilmersdorf
Weitere KurzInfos zu Veranstaltungen und Themen rund um den Klausenerplatz-Kiez jetzt immer auch
bei Twitter (ohne Anmeldung einsehbar!) und
bei Facebook.
Weitere Termine auch stets im StadtteilKalender für Charlottenburg-Wilmersdorf des Nachbarschaftshauses am Lietzensee.
- Geschichte, Kunst und Kultur -
Berliner Theaterclub ehrte verdienstvolle Künstler
Seit 39 Jahren verleihen die Mitglieder des Berliner Theaterclub den „Goldenen Vorhang“ an ihre beliebtesten Darsteller der Saison. Doch in diesem Jahr wurde ein Rahmen gefunden, der alles bisher Dagewesene übertraf.
So war die Preisverleihung am Montag, 30. November, für die Ausgezeichneten keineswegs Routine, obwohl beide Preisträger - Katharine Mehrling und Boris Aljinovic - in der gleichen Konstellation wie schon 2013 ausgezeichnet wurden. Boris Aljinovic schwebte vom Schnürboden herab und Katharine Mehrling wurde auf der Bühne vom ehemaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit begrüßt. Er würdigte sie mit einer Laudatio, eine Aufgabe, die bislang zumeist Schauspielerkollegen zukam. Für Boris Aljinovic wurde die Lobrede vom Theaterkritiker Peter Hans Göpfert vorgetragen. Katharine Mehrling erhielt bereits zum vierten Male den „Goldenen Vorhang“. Ihre Popularität gewann sie in der vergangenen Saison mit vier Rollen: an der Komischen Oper spielte sie in „Arizona Lady“ und im „Ball im Savoy“ sowie am Renaissance-Theater in „Fast Normal“ und in „Ewig Jung“. Boris Aljinovic, der den „Goldenen Vorhang“ zum zweiten Mal erhielt, spielte sich am Renaissance-Theater in den Produktionen „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ und „Unwiderstehlich“ in die Herzen der Zuschauer.
Preisträger Boris Aljinovic schwebt von oben herab.
Foto: Wecker
Katharine Mehrling freut sich unbändig über den Preis.
Foto: Wecker.
[weiterlesen]
FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -
Mit Pauken und Trompeten in den Advent
Zum ersten Advent, 29. November 20 Uhr, lädt die Berliner Bach Akademie zur Aufführung des ersten Teils des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in den Kammermusiksaal der Philharmonie, Herbert-von-Karajan-Straße 1, ein.
Ergänzend zum ersten Teil des Weihnachtsoratoriums wird auch das Magnificat, der Lobgesang der Maria, zu Gehör gebracht. Die Berliner Bach Akademie ist zwar ein Laienchor, doch ist es dem Gründer Heribert Breuer in den 24 Jahren, die seit der Gründung des Ensembles vergangen sind, gelungen, für seinen Klangkörper solch ambitionierte Musiker zu gewinnen, daß die Laienkünstler gemeinsam mit hochkarätigen Berufsmusikern in die besten Konzertsäle eingeladen werden. Zum Adventskonzert musizieren sie gemeinsam mit mehrfachen Preisträgern bei internationalen Gesangswettbewerben. Das sind die Sopranistin Anna Nesyba, die Altistin Britta Schwarz, der Tenor Daniel Johansen, und der Bariton Klaus Häger. Im Orchester wirken unter anderem der preisgekrönte Oboist Thomas Hecker und der Solofagottist des Deutschen Symphonieorchesters Jörg Petersen mit. Das Konzert wird von Heribert Breuer geleitet. Karten ab 19 Euro gibt es unter Telefon: 01806-57 00 70, an den Theaterkassen und im Internet unter: www.berlinerbachakademie.de.
Frank Wecker
Auftritt der Berliner Bach Akademie im Kammermusiksaal der Philharmonie.
Foto: Peter Adamik
FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -
Kabarett „Die Stachelschweine“ präsentieren neues Programm
Es muß sich vorab herumgesprochen haben, daß es das neue Programm der Stachelschweine „Globale Betäubung“ in sich hat, denn so viel Prominenz war schon lange nicht mehr zur Premiere im Untergeschoß des Europacenters zu sehen. Trotz des verkaufsoffenen Sonntags waren es die Stachelschweine, die am meisten Leben in das Wahrzeichen der City-West brachten.
Lang anhaltender Beifall, Bravorufe und Szenenapplaus zeigten an, daß der dem Programm vorauseilende Ruf die Erwartungen des Premierenpublikums erfüllte. Von der Flüchtlingsproblematik über TTIP bis zum Grexit wurde in der alptraumhaften Szenerie eines privatisierten Krankenhauses jedes heiße Eisen angepackt und derart geschmiedet, daß aus der Asche des Feuers nur eine triste Zukunft orakelt werden kann. Allein Hoffnung gibt, daß die todkrank ins Krankenhaus eingelieferte Demokratie am Ende der Vorstellung das Gebäude schon wieder auf eigenen Füßen verlassen konnte. „Warum machen wir alle mit?“: Diese von Birgit Edenharter in den Saal geschleuderte Frage, konnte das Publikum auch nur mit Lachen und Beifall beantworten. Es ist schließlich kein Revolutionstheater, was bei den Stachelschweinen zelebriert wird, sondern politisches Kabarett von der besten Art, der Tradition des Ensembles gerecht und auf Augenhöhe mit Produktionen wie „Die Anstalt“ im ZDF. Den größten Szeneapplaus erhielt jener Akt, als die Kabarettisten dem Staat die Rechnung über die Verschleuderung von Milliarden bei den Großprojekten wie BER und Stuttgart 21 präsentierten.
Neun Autoren haben die Pointen geliefert, die von dem vierköpfigen Schauspielerensemble bravourös serviert wurden. Als Primus inter Pares erwies sich wieder einmal Birgit Edenharter, die das Publikum als Pflegeroboter zu Lachsalven hinriß, Alexander Pluquett holte sich mit der Figur eines Europapolitikers der SPD mehrfachen Szenenapplaus, Kirstin Wolf und Holger Güttersberger nutzten jede Chance, und das waren sehr viele, die ihnen die Autoren gaben, um die Stimmung im Saal hochzuhalten. Mit ihrem Stimmen aus dem Off werden diese Akteure von Brigitte Heinrich, Marion Sawtzki und Wolfgang Bahro unterstützt.
Das Programm wird jeweils Dienstag bis Freitag um 20 Uhr und sonnabends um 18 Uhr gezeigt. Karten ab 19 Euro können unter Telefon 261 47 95 und im Internet unter www.diestachelschweine.de vorbestellt werden.
Frank Wecker
FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -
Pay Matthis Karstens wird wieder fündig
Gleich zwei Entdeckungen bietet der von Pay Matthis Karstens herausgegebene Band „Der unbekannte Zille“: Zum einen wird die bislang von der Forschung weitgehend ignorierte sozialkritische Komponente in Zilles Schaffen beleuchtet, die wiederum, das ist die zweite Entdeckung, nicht Pay Matthis Karstens herausgearbeitet hat, sondern der völlig in Vergessenheit geratene Schriftsteller Erich Knauf. Der schrieb Anfang der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts jenen biografischen Roman „Der unbekannte Zille“, dem nunmehr mit gut 80 Jahren Verspätung Pay Matthis Karstens den Weg in die Öffentlichkeit gebahnt hat.
Der erst 26 Jahre alte Charlottenburger Kunsthistoriker hatte sich jedoch bereits vor dieser Entdeckung in die Annalen der Wissenschaft eingeschrieben. Er arbeitet für die Berlinische Galerie und das Deutsche Historische Museum; er ist Gründer des Jungen Freundeskreises der Liebermann-Villa und ist mit Publikationen sowie Ausstellungen zur deutschen Kunst des 20. Jahrhunderts hervorgetreten. Er hat sich mit Arbeiten zu den Fotografien und der Rezeptionsgeschichte Heinrich Zilles Verdienste erworben. Wissenschaftliches Neuland betrat er erstmals mit seiner Publikation „Verboten und verfälscht. Heinrich Zille im Nationalsozialismus“. Akribisch hat er als erster herausgearbeitet, wie die Nazis „Pinselheinrich“ für ihre Zwecke zu vereinnahmen suchten, indem sie aus Zille „einen antisemitischen Vorarbeiter des Nationalsozialismus“ machen wollten. Dem Heimatmuseum des Bezirkes war dies vor zwei Jahren die Sonderausstellung „Zensur und Willkür. Das Werk Heinrich Zilles im Nationalsozialismus“ wert.
Heinrich Zille: Alte Frau mit Kiepen – Reisigsammlerin, um 1902,
Bleistift, mit Feder laviert auf Papier,
25 x 17 cm, Inv.-Nr. GR 07/26
HZ, © Stiftung Stadtmuseum Berlin, Reproduktion: Oliver Ziebe, Berlin.
[weiterlesen]
FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -
Ein Theater, ein Thema, aber zwei ganz unterschiedliche Aufführungen
Mit zwei neuen Produktionen begleiten die Ku‘dammbühnen ihr Publikum in den Herbst. In beiden geht es um die intensivste und schönste Beziehung zwischen Menschen – die Liebe, doch mehr Gemeinsamkeiten haben die beiden Inszenierungen nicht.
Das Theater am Kurfürstendamm zeigt „Die Wunderübung“. Rüdiger Hentzschel inszeniert dieses Stück von Daniel Glattauer, mit dessen „Gut gegen Nordwind“ die Woelfferbühnen bereits zweimal gute Erfahrungen gemacht haben. Damals standen Tanja Wedhorn und Oliver Mommsen auf der Bühne. Jetzt gelang es erneut, ein hochkarätiges Ensemble mit aus Film- und Fernsehproduktionen bekannten Schauspielern zu bilden. Es spielen Elisabeth Lanz, Götz Otto und Peter Prager. Die Geschichte ist einfach und gewinnt im Laufe der Handlung an Amüsement: Ein Paar, das sich auseinandergelebt hat, sucht Rat bei einem Therapeuten, den Peter Prager spielt. Gleichzeitig geht die Beziehung des Therapeuten in die Brüche, der nun aber Hilfe und Unterstützung bei seinen selbst hilfesuchenden Klienten findet.
Peter Prager, Götz Otto und Elisabeth Lanz in „Die Wunderübung“ in der Komödie am Kurfürstendamm.
Foto: Wecker
Götz Otto und Elisabeth Lanz in „Die Wunderübung“ in der Komödie am Kurfürstendamm.
Foto: Wecker
[weiterlesen]
FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -